
Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch einen wertschätzenden Umgang mit Schülerbeiträgen
Die Bedeutung mündlicher Unterrichtsbeiträge

Mündliche Unterrichtsbeiträge spielen eine zentrale Rolle im Rahmen der sprachlichen Bildung und somit im gesamten Unterricht. Zudem können sie wesentlich zum Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler beitragen. Die Bedeutung mündlicher Beiträge im Unterricht ist somit in vielerlei Hinsicht immens:
Einerseits werden Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, sich aktiv am Unterrichtsgeschehen zu beteiligen, anstatt Inhalte passiv aufzunehmen. Durch die verbale Einbindung setzen sie sich automatisch intensiver mit dem Lernstoff auseinander. Dabei trainieren sie, ihre Gedanken klar und strukturiert auszudrücken. Neben der Unterstützung des fachlichen Lernens, fördern mündliche Unterrichtsbeiträge auch die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler. Sie verbessern einerseits ihre Argumentationsfähigkeit und lernen auf diese Weise auch, zuzuhören, die Meinungen anderer zu akzeptieren und ggf. respektvoll und empathisch darauf einzugehen. Lehrkräfte erhalten durch mündliche Beiträge Einblick in den Lernstand der Schülerinnen und Schüler. Sie können Verständnisprobleme frühzeitig erkennen und gezielt darauf eingehen. Die Art des Umgangs der Lehrkraft mit mündlichen Unterrichtsbeiträgen ist entscheidend für eine gelingende Beziehung zu den Lernenden und hat durchaus Auswirkungen auf deren Lernerfolg.
Ein wertschätzender Umgang mit mündlichen Beiträgen im Fremdsprachenunterricht ist besonders wichtig, weil er die Schülerinnen und Schüler nicht nur beim Sprachlernen, sondern auch in ihrer Bereitschaft, mündliche Unterrichtsbeiträge zu tätigen, unterstützt. Nachfolgend einige zentrale Gründe:
Förderung der Sprachkompetenz:
Englischunterricht lebt von der aktiven Sprachpraxis. Ein wertschätzender Umgang ermutigt die Lernenden, ihre Sprachkenntnisse zu erproben, ohne Angst vor Fehlern haben zu müssen. Dies ist entscheidend, da viele Schülerinnen und Schüler Hemmungen verspüren, sich mündlich in einer fremden Sprache zu äußern. Gezielte Wertschätzung für den Versuch, sich in der Fremdsprache auszudrücken, stärkt die Sprechsicherheit und fördert die sprachliche Entwicklung.
Abbau von Sprachbarrieren und Ängsten:
Gerade im Fremdsprachenunterricht reagieren viele Schülerinnen und Schüler zurückhaltend, da sie Bedenken haben sich nicht richtig auszudrücken oder beispielsweise ein Wort falsch auszusprechen. Wenn sie wissen, dass ihre Beiträge von allen positiv aufgenommen und respektiert werden, sinkt die Hemmschwelle. Die Schülerinnen und Schüler verinnerlichen, dass nicht die Perfektion zählt, sondern der Mut, sich mitzuteilen und neue Worte und Satzstrukturen auszuprobieren. Dieses Vertrauen in die eigenen Sprachfähigkeiten ist eine entscheidende Grundlage für den weiteren Sprachlernprozess.
Förderung interkultureller Kompetenz:
Im Fremdsprachenunterricht geht es häufig um kulturelle Themen derer Länder, in denen die Zielsprache gesprochen wird. Hier werden auch Meinungen und Interpretationen gefordert. Eine wertschätzende Unterrichtsatmosphäre ermöglicht es den Schülerinnen und Schülern, sich offen über andere Kulturen und Lebensweisen auszutauschen. Dies stärkt nicht nur das Verständnis und die Akzeptanz für die vielen verschiedenen Sprachen auf der Welt, sondern fördert auch die Offenheit und den Respekt für kulturelle Unterschiede.
Wertschätzender Umgang mit mündlichen Äußerungen im Unterricht darf nicht dazu führen, unkritisch Unterrichtsbeiträge zu loben, die offensichtlich fehlerbehaftet bzw. in der einen oder anderen Hinsicht nicht zufriedenstellend sind. Übermäßiges Loben kann, obwohl gut gemeint, einige ungewollte Auswirkungen haben und das Lernen der Schülerinnen und Schüler sogar behindern:
Verlust der Glaubwürdigkeit:
Wenn Lehrkräfte jede Äußerung oder Leistung übermäßig loben, wirkt das Lob bald weniger authentisch und verliert an Wirkung. Die Schülerinnen und Schüler könnten das Gefühl bekommen, dass es nicht ernst gemeint ist. Somit verliert ein gut gemeintes Lob an Bedeutung und wirkt dann abgeschwächt, da es nicht mehr als „besondere“ Wertschätzung wahrgenommen wird.
Verminderte Motivation, sich zu verbessern:
Übermäßiges Lob, vor allem für einfache oder fehlerhafte Beiträge, kann dazu führen, dass die Schülerinnen und Schüler weniger Einsatzbereitschaft im Unterricht zeigen, da sie den Eindruck haben, dass ihre aktuelle Leistung bereits dem gewünschten Maße entspricht.
Abhängigkeit vom Lob:
Wenn Schülerinnen und Schüler ständig gelobt werden, könnte dies eine Form der Bestätigung werden, die sie benötigen, um sich sicher und wohl zu fühlen. Sie gewöhnen sich daran, dass ihre Beiträge immer positiv verstärkt werden, und werden verunsichert, wenn dies einmal ausbleibt. Die Selbstständigkeit im Sprachlernprozess wird beeinträchtigt und stark vom Feedback anderer abhängig.
Übersehen von Verbesserungspotenzial:
Ständiges Lob kann dazu führen, dass konstruktives Feedback ausbleibt. Die Schülerinnen und Schüler bekommen möglicherweise nicht die Hinweise, die sie benötigen, um ihre Sprachfähigkeiten zu verbessern, wie z. B. auf häufige Grammatikfehler, Ausspracheprobleme oder den Ausbau des Wortschatzes. Ohne klare Rückmeldung ist es schwieriger, Fortschritte zu erkennen und gezielt an Schwächen zu arbeiten.
Entstehung einer unrealistischen Selbsteinschätzung:
Die Schülerinnen und Schüler könnten aufgrund des übermäßigen Lobs ein unrealistisches Bild ihrer tatsächlichen Sprachfähigkeiten entwickeln. Sie überschätzen dann ihre Sprachkenntnisse und sind enttäuscht, wenn sie auf Schwierigkeiten stoßen.
à Ein ausgewogenes Feedback ist daher entscheidend. Lob sollte authentisch, gezielt und konstruktiv sein, um die Sprachentwicklung zu fördern und die Lernenden zu motivieren. Ein ausgewogenes Verhältnis von Anerkennung und konkreter Rückmeldung gibt den Schülerinnen und Schülern das Selbstvertrauen, weiter zulernen und sich kontinuierlich zu verbessern.
Die Art und Weise der Rückmeldung durch die Lehrkraft sollte nicht zuletzt von der individuellen Unterrichtsphase abhängig gemacht werden.
Wird beispielsweise eine neue Struktur besprochen, so kann ausbleibende Fehlerkorrektur zur ungewollten Festigung von Fehlern führen. Insofern ist dringend davon abzuraten, in dieser Phase des Unterrichts, in der die Automatisierung einer neuen Struktur im Vordergrund steht, auf direkte Korrekturen zu verzichten.
In der Phase des Unterrichts, die auf Kommunikation fokussiert ist, kann wiederum unbedachte, spontane Fehlerkorrektur, die dazu führt, dass die Aussagen der Schülerin / des Schülers wiederholt unterbrochen werden, dazu führen, dass die Lernenden entweder den Faden oder die Motivation zum Fortsetzen ihrer Äußerung verlieren.
Auch in der Phase der Leistungsbewertung wird Rückmeldung an die Schülerinnen und Schüler gegeben. Den Lernenden sollte jedoch bewusst gemacht werden, dass neben der Förderung des Lernprozesses in dieser Phase speziell die objektive Bewertung der derzeitigen Leistungsfähigkeit bezogen auf eine bestimmte Kompetenz im Vordergrund steht. Lern- und Leistungsphasen sollten den Schülerinnen und Schülern transparent aufgezeigt werden.







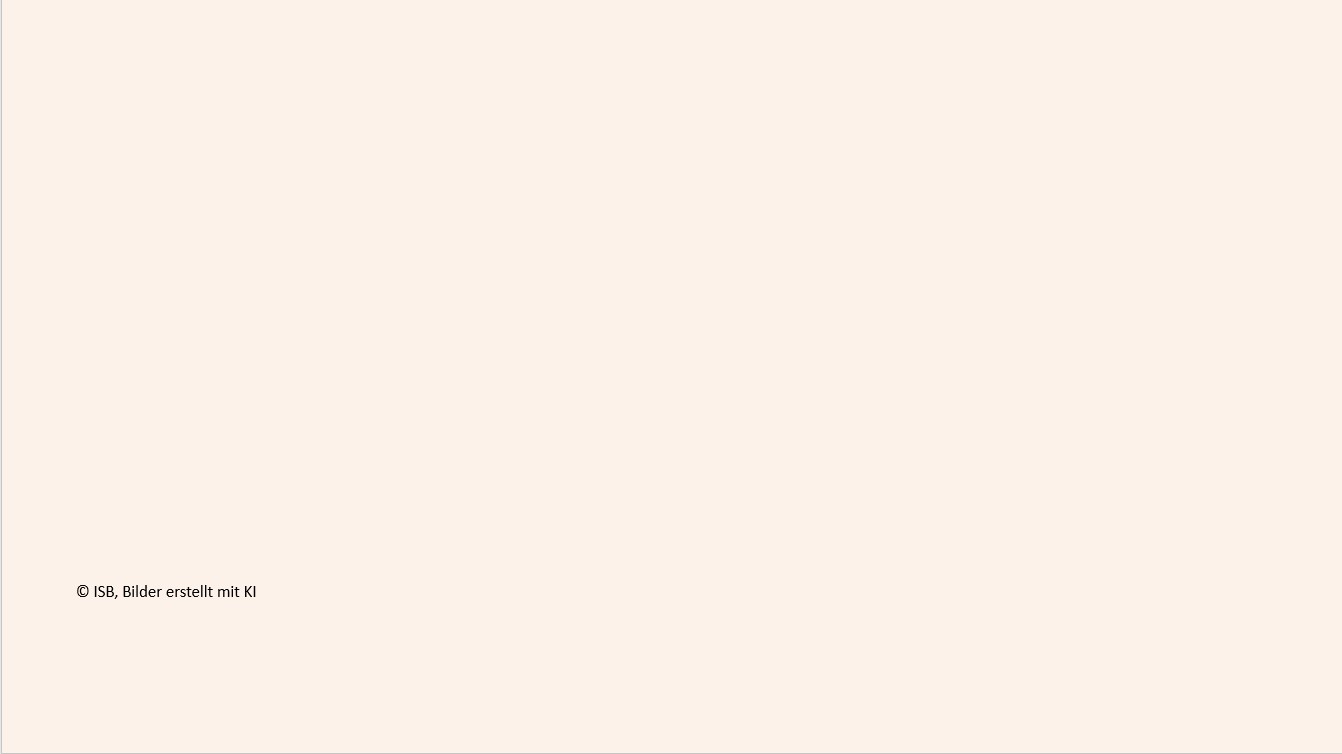
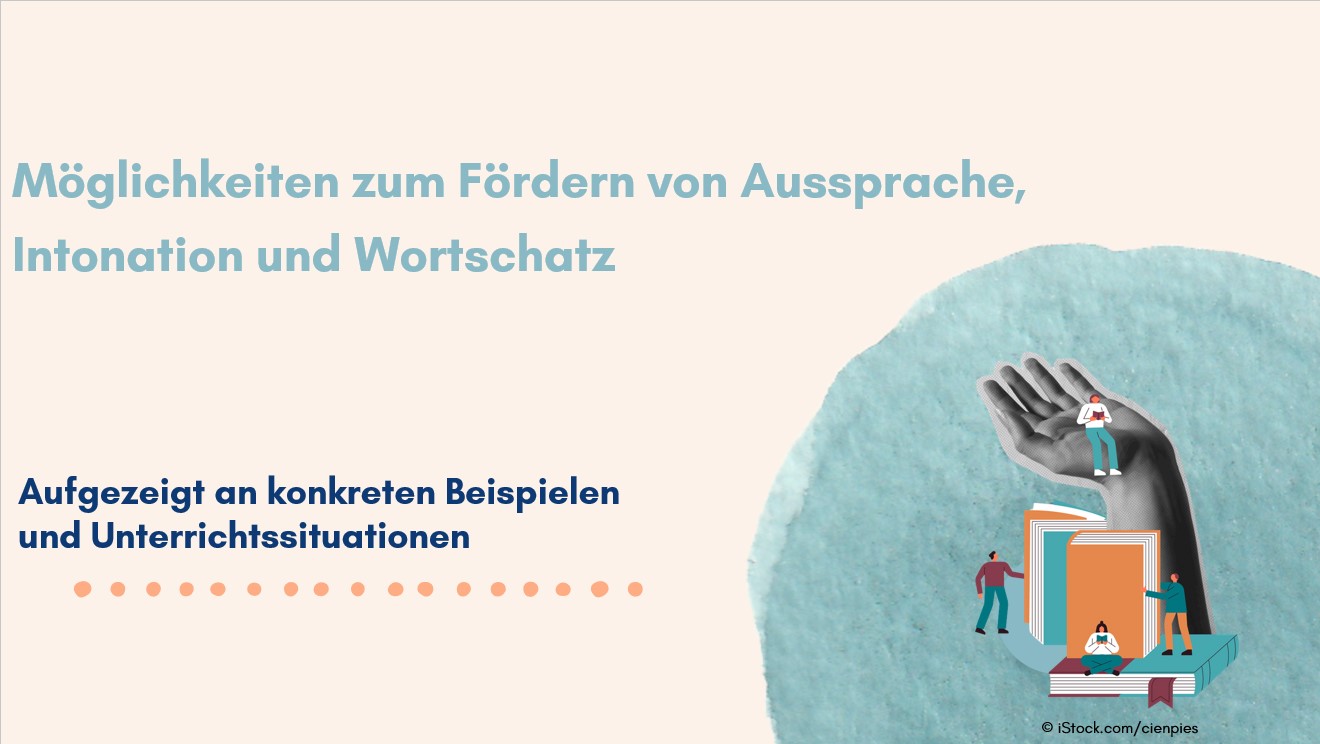
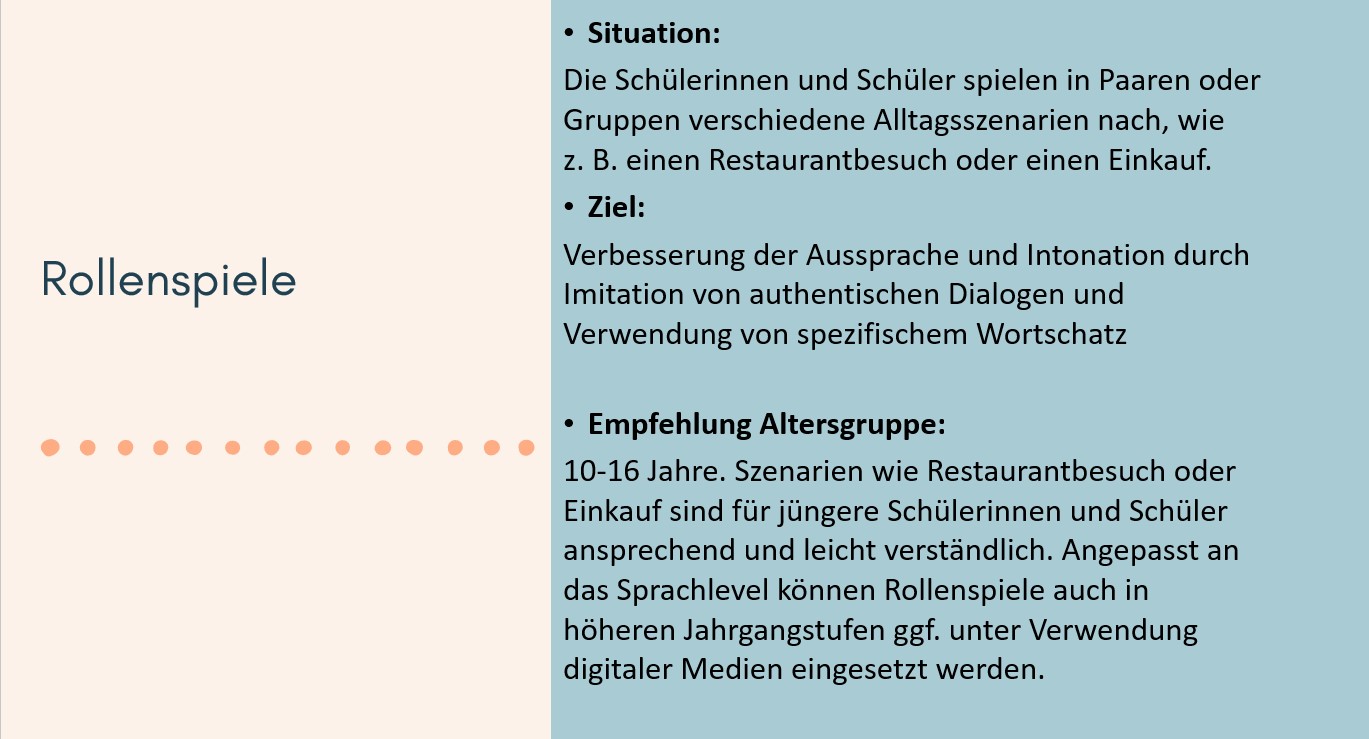
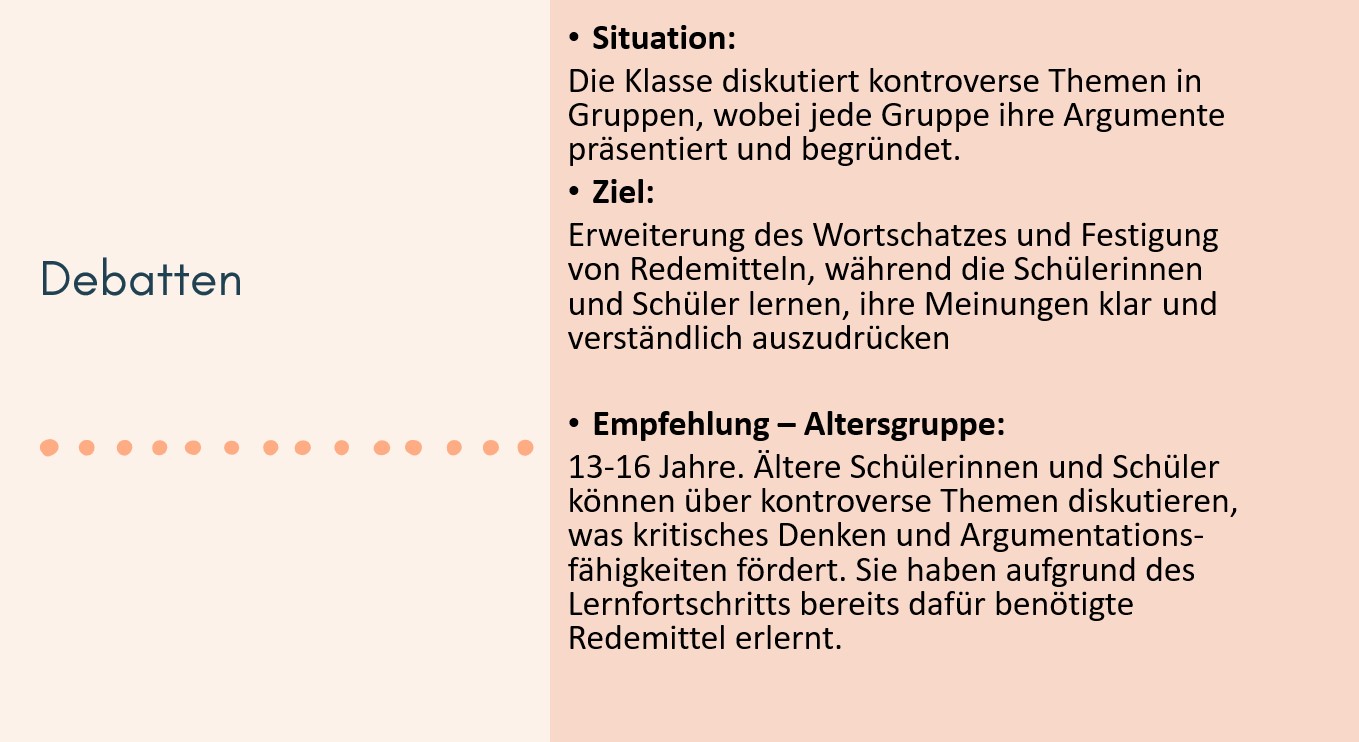
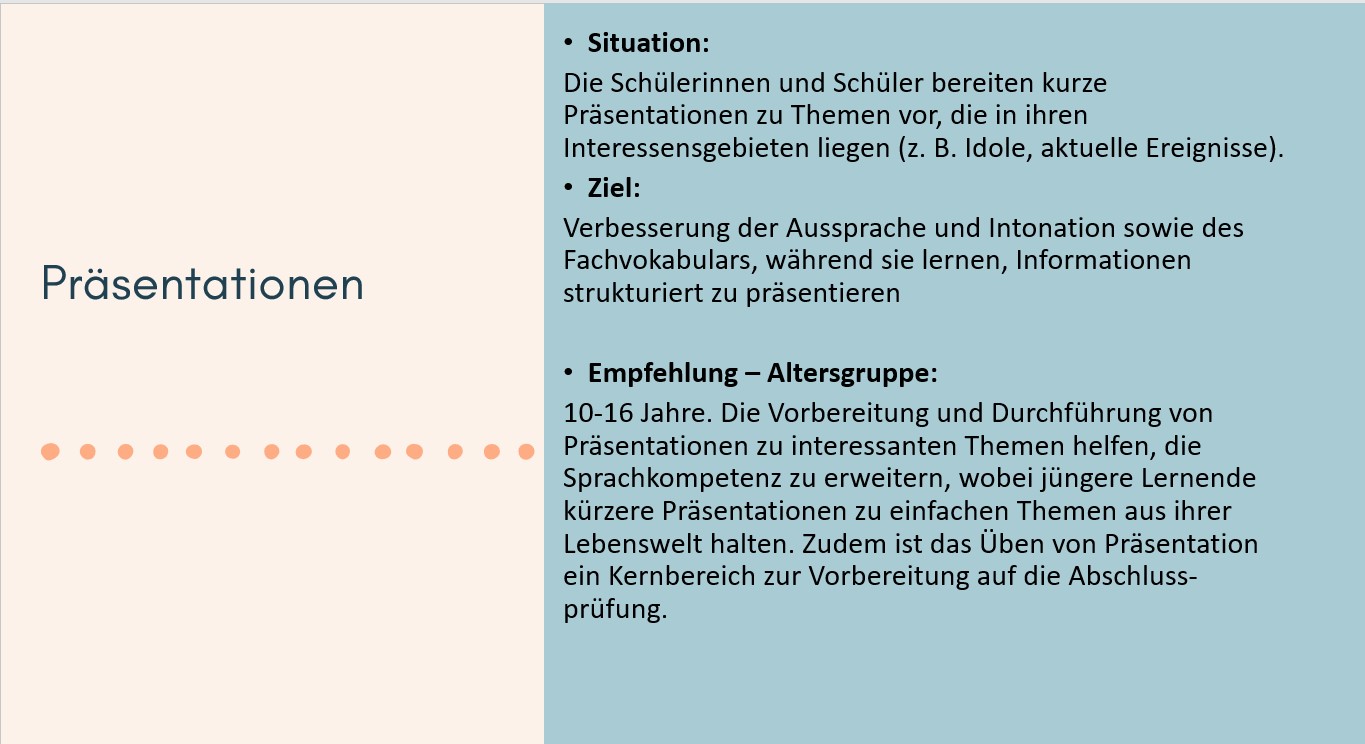
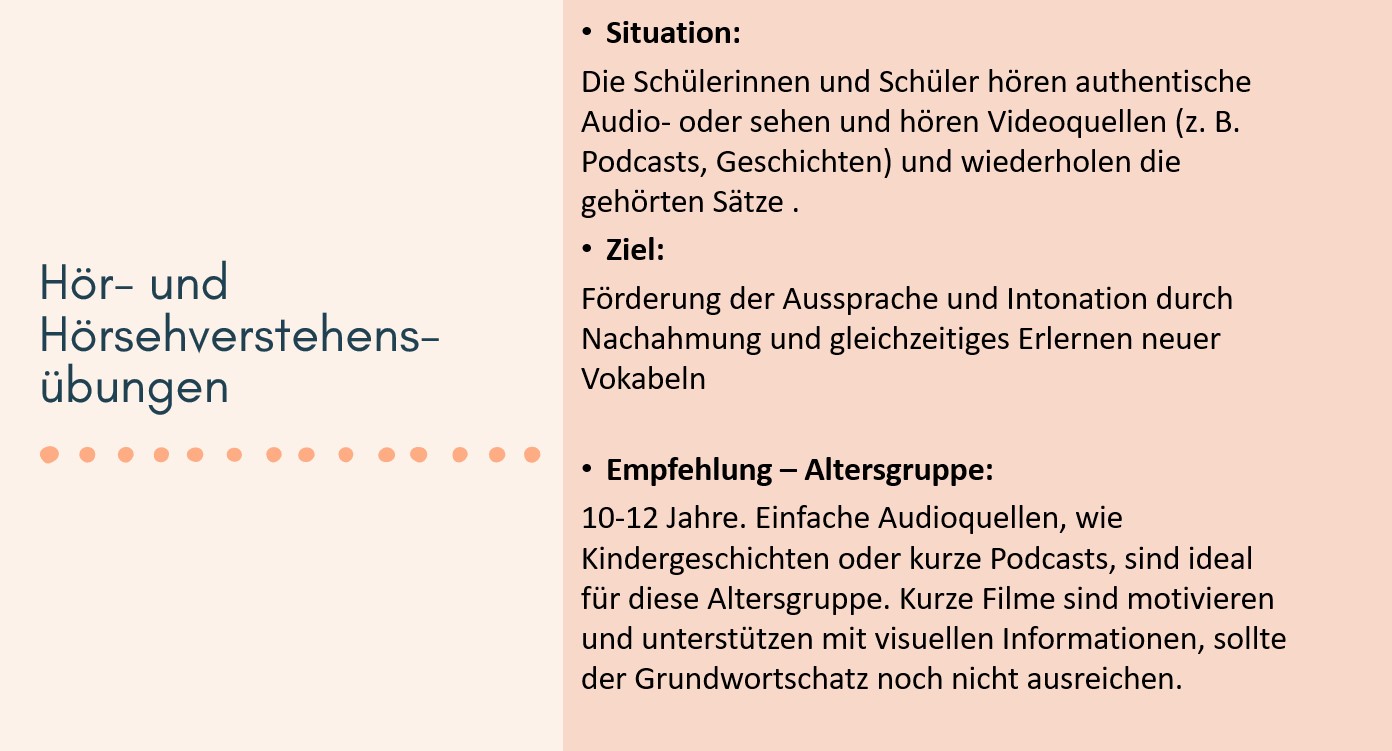
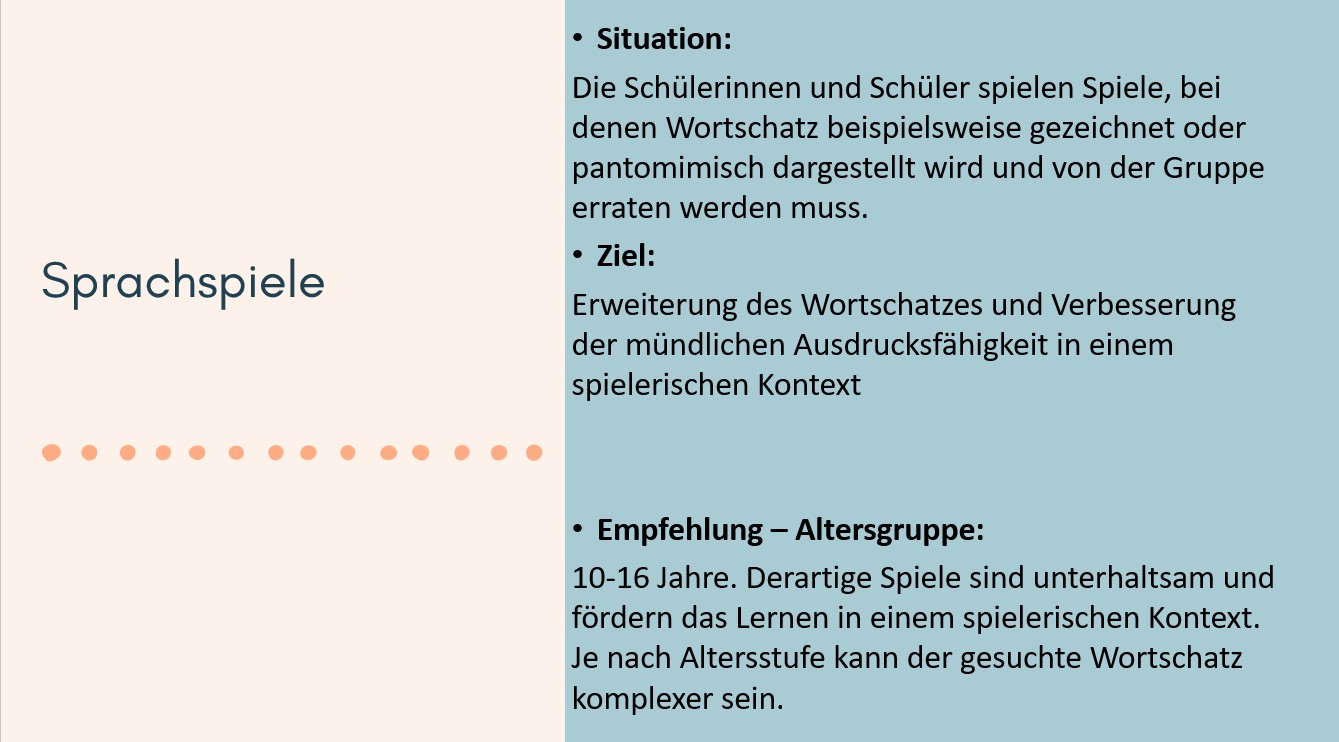
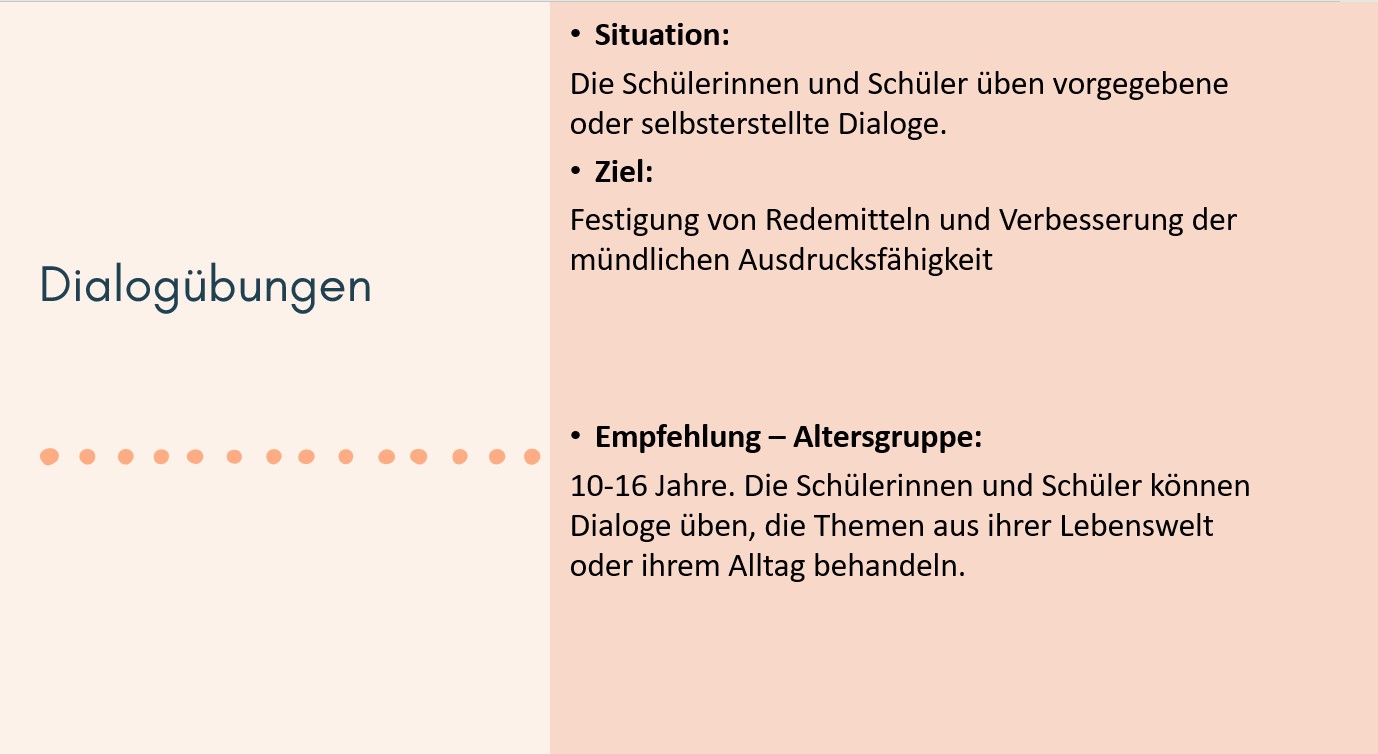
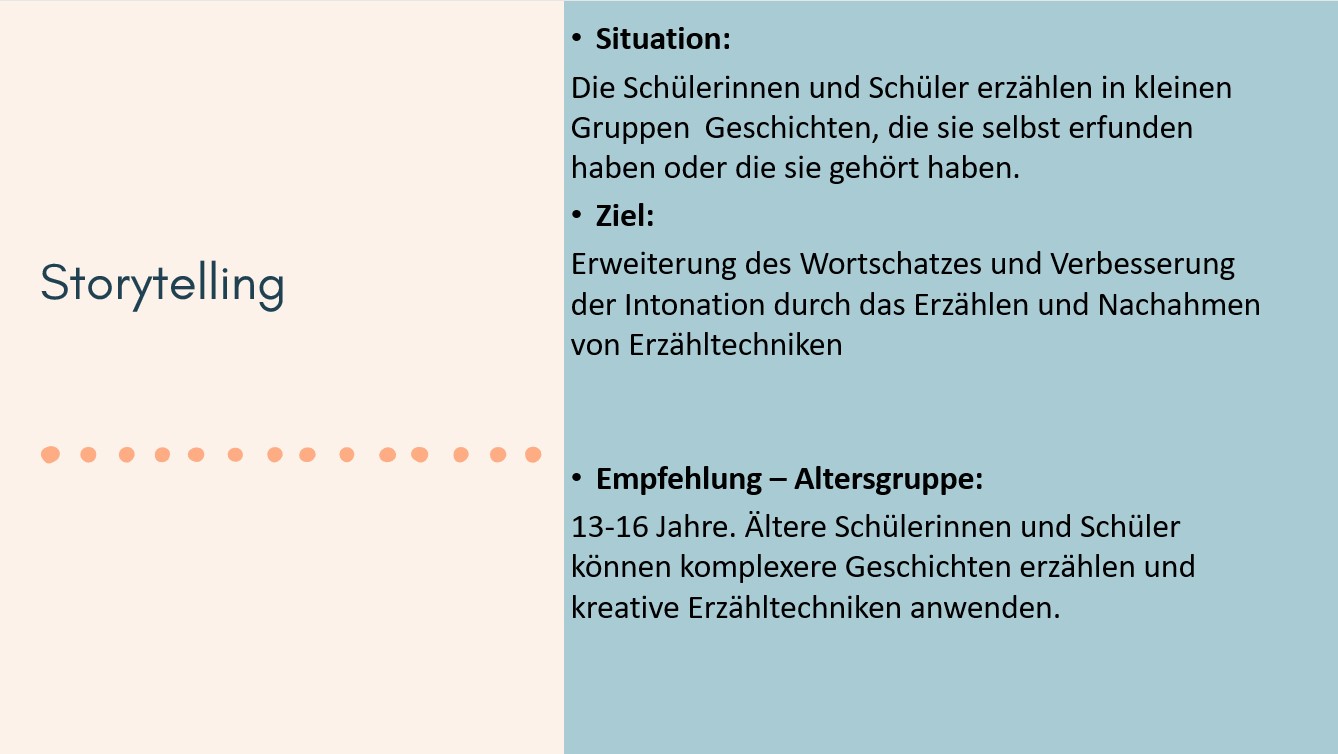
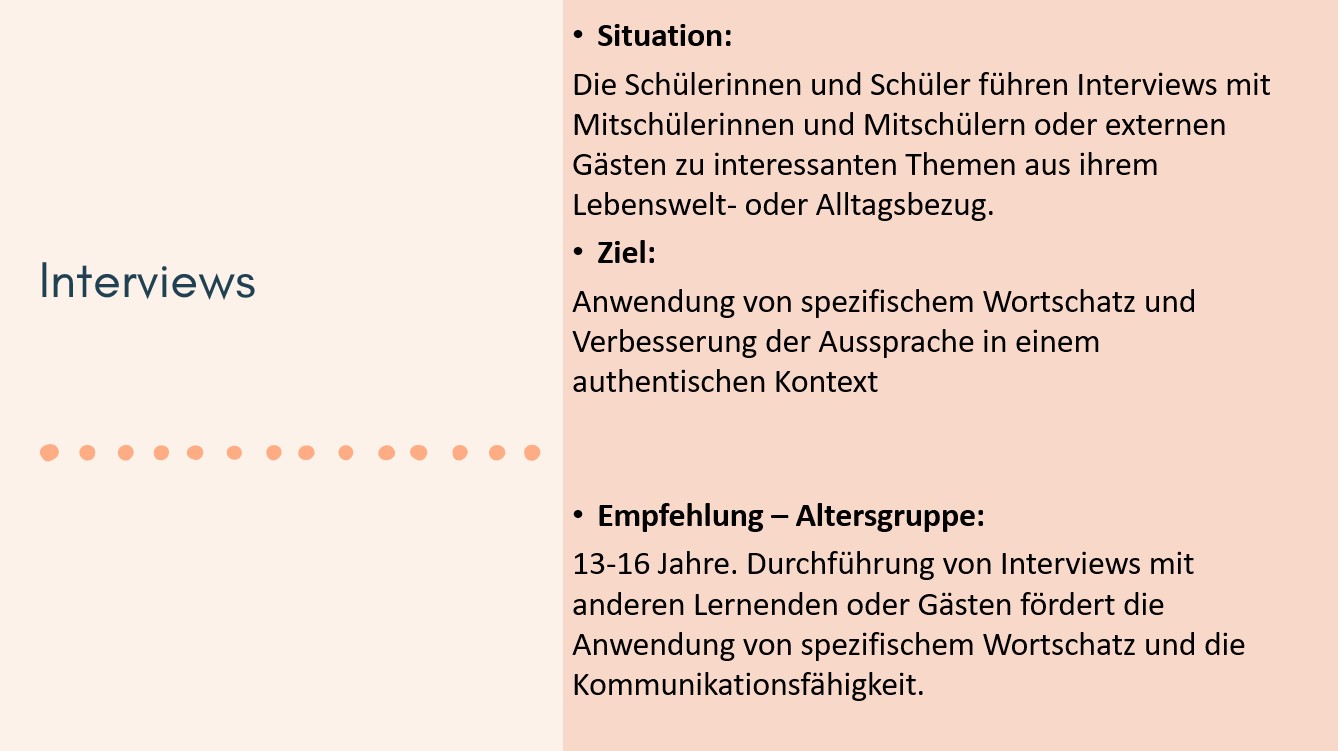
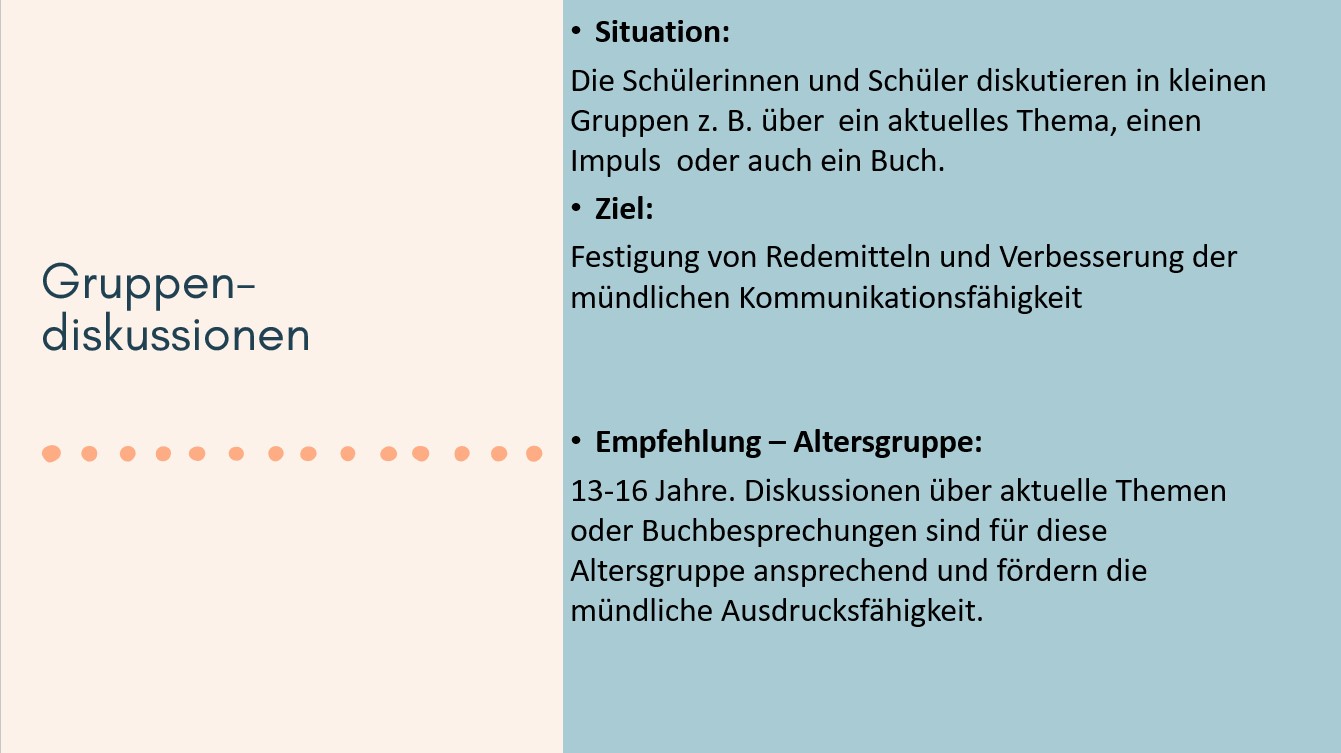
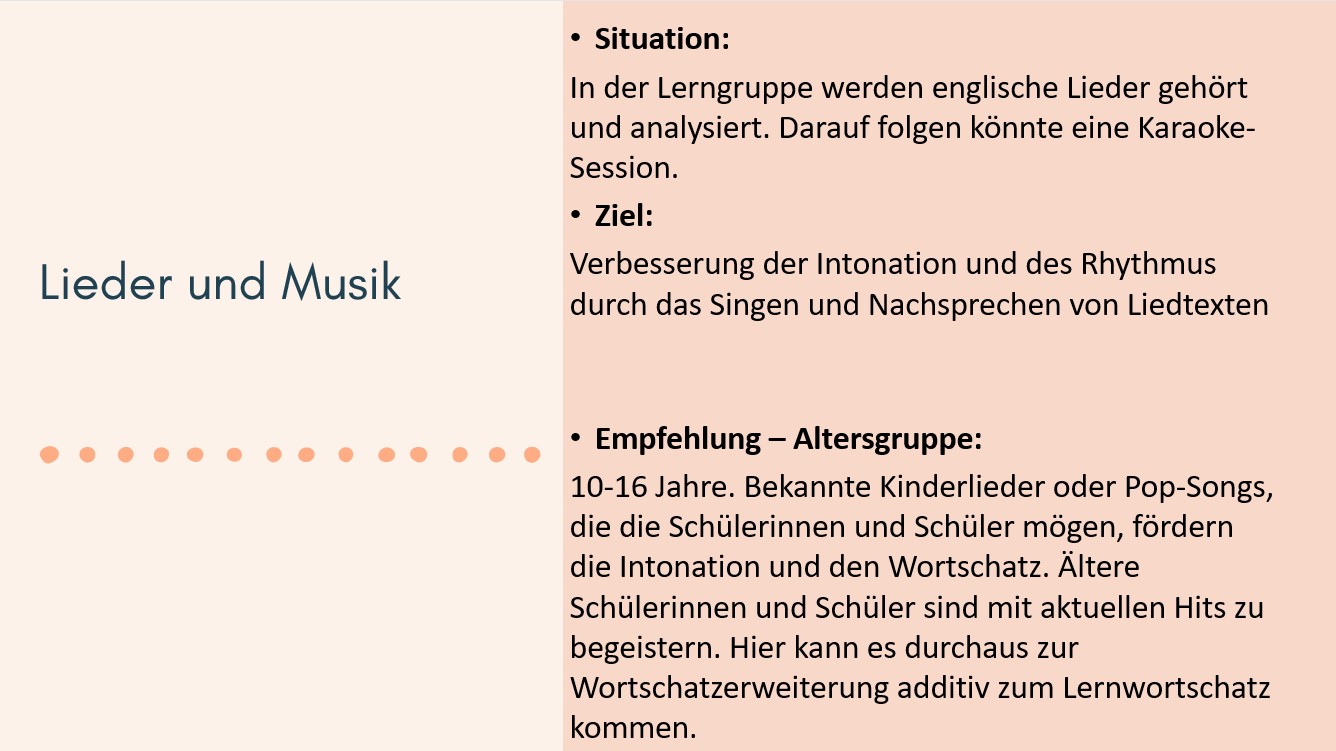

- Fengler, Jörg: Feedback geben: Strategien und Übungen; Beltz, 2004
- Hattie, John und Helen Timperley: Die Wirkung von Feedback, in: Jahrbuch für Allgemeine Didaktik (2016); Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren
- Sommer, Angela: Wertschätzendes Feedback in Schulen, in: Lernchancen 86 (2012), S. 28 – 32; Seelze: Friedrich Verlag GmbH
- Bilder und Illustrationen erstellt mit Hilfe von KI am 01.05.2025


