
Lernwirksamer Unterricht wird ermöglicht durch einen selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernprozess: Beispiel Themenwoche

Der Schulalltag ist oft geprägt von festen Strukturen, Curricula und dem Bestreben, eine Vielzahl von Inhalten in verschiedenen Unterrichtsfächern zu vermitteln. Doch wie oft sehnen wir uns nach der Möglichkeit, den Unterrichtsrahmen auszudehnen, fächerübergreifende Verbindungen zu schaffen und den Schülerinnen und Schülern Lernerfahrungen zu bieten, die über das Klassenzimmer hinausgehen? Themenwochen sind hierfür ein erprobtes und dynamisches Format, das Schulen die Chance bietet, genau diese Ziele zu verwirklichen und den Unterricht mit neuer Energie zu beleben.
Eine Themenwoche im schulischen Kontext bezeichnet einen festgelegten Zeitraum, in dem sich die Schülerinnen und Schüler intensiv mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen. Während dieser Woche wird der reguläre Unterrichtsplan häufig ausgesetzt oder angepasst, um fächerübergreifende Projekte, Workshops und Exkursionen zu ermöglichen, die das gewählte Thema vertiefen. Ziel ist es, durch interdisziplinäres Lernen die Motivation der Lernenden zu steigern und ein umfassenderes Verständnis für komplexe Sachverhalte zu fördern. Themenwochen wirken sich außerdem motivierend aus und fördern das soziale Miteinander – auch über eine feste Klassengruppe hinaus.
1. Anpassung des Unterrichtsplans
Während einer Themenwoche kann der geltende Stundenplan angepasst, je nach Fragestellung müssen sogar Zeitstrukturen, Lernorte und Lerngruppen zugunsten des Vorhabens verändert werden. So wäre es beispielsweise sinnvoll, bei einer Themenwoche mit dem Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ den regulären Stundenplan aufzulösen, sodass die Schülerinnen und Schüler jahrgangsübergreifend in Projektgruppen arbeiten. Die gewohnten Klassenzimmer werden gegebenenfalls durch alternative Lernorte, wie zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaftsbetriebe oder Recyclinghöfe ersetzt, um authentische und lebensnahe Lernerfahrungen zu ermöglichen. In diesem Zuge wäre es auch empfehlenswert, die Zeitstruktur anzupassen und die Gruppen ganztägig und nicht nur während einzelner Unterrichtsstunden an ihren Themen arbeiten zu lassen.
2. Fächerübergreifende Projekte und Workshops
Themenwochen bieten eine gute Gelegenheit, um fächerübergreifende Projekte im Schulalltag umzusetzen: „Projektförmiger Unterricht stellt den gemeinsam von Lehrkräften, Lernenden, hinzugezogenen Eltern und Experten unternommenen Versuch dar, Leben, Lernen und Arbeiten derart zu verbinden, dass ein gesellschaftlich relevantes, zugleich der individuellen Bedürfnis- und Interessenlage der Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler, entsprechendes Thema oder Problem innerhalb und außerhalb des Klassenzimmers aufgearbeitet werden kann. Der Arbeits- und Lernprozess, der durch die Projektidee ausgelöst und organisiert wird, ist dabei ebenso wichtig, wie das Handlungsergebnis oder Produkt, das am Ende des Projekts stehen soll. Projekte eröffnen die Chance, die gesellschaftlich vorgegebene Trennung von Kopf- und Handarbeit ein Stück weit aufzuheben.“ (Meyer, Hilbert/Junghans, Carola: Unterrichtsmethoden II. Praxisband, Berlin 202117, S. 144.)
Dahingegen versteht man unter fächerübergreifendem Unterricht als Unterrichtsform, komplexe Realsituationen zu thematisieren, die nicht explizit einem Fach zugeordnet werden können. Durch die Integration verschiedener Fachperspektiven sollen Schülerinnen und Schüler befähigt werden, komplexe Probleme durch vernetztes Denken und fachübergreifende Strukturierung ihres Wissens zu lösen. (Vgl. Peterßen, Wilhelm: Fächerverbindender Unterricht. Begriff, Konzept, Planung, Beispiele, München 2000, S. 65.)
3. Exkursionen
Während Themenwochen können Exkursionen durchgeführt werden, sofern dies zur Fragestellung passt. Unter einer Exkursion versteht man eine Lehrveranstaltung, bei der Lernende den traditionellen Klassenraum verlassen, um vor Ort spezifische Lernziele zu verfolgen. Dieses didaktische Mittel ermöglicht es, theoretische Inhalte durch direkte Erfahrungen zu vertiefen und fördert die Verknüpfung von Theorie und Praxis. (Vgl. Stolz, Christian/Feiler, Benjamin: Exkursionsdidaktik. Ein fächerübergreifender Praxisratgeber für Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung, Stuttgart 2018, S. 10.)
Bezogen auf das o.g. Beispiel zur Themenwoche „Nachhaltigkeit“ könnte exemplarisch mit einer Lerngruppe ein Recyclinghof besucht werden. Dabei ergründen die Schülerinnen und Schüler die Frage „Was geschieht mit unserem Müll?“ und erfahren, wie Werkstoffe wie z. B. Glas, Metall oder Plastik recycelt und wiederverwendet werden können.
Die Planung sowie Durchführung einer Themenwoche an Schulen umfasst mehrere Phasen, die systematisch aufeinander aufbauen, um ein effektives und nachhaltiges Lernen zu gewährleisten. Eine wissenschaftlich fundierte Betrachtung dieser Phasen findet sich im Modell des Projektunterrichts, das häufig auf Themenwochen angewendet wird. Dieses Modell unterteilt den Prozess in sechs zentrale Phasen (Warwitz, Siegbert/Rudolf, Anita: Projektunterricht. Didaktische Grundlagen und Modelle, Schorndorf 1977, S. 41.):
-
Sondierungsphase: In dieser initialen Phase werden die Anforderungen und die Machbarkeit des Projekts überprüft. Es erfolgt eine Analyse der curricularen Vorgaben, der Interessen und des Vorwissens der Lernenden sowie der verfügbaren Ressourcen. Ziel ist es, ein klares Verständnis für die Rahmenbedingungen und Möglichkeiten des Projekts zu entwickeln.
-
Motivationsphase: Hier steht die Aktivierung und Steigerung der Motivation der Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt. Durch Methoden wie Brainstorming werden gemeinsame Ziele definiert und ein starkes Interesse am Thema geweckt. Diese Phase legt den Grundstein für ein engagiertes und zielorientiertes Arbeiten.
-
Planungsphase: Basierend auf den Erkenntnissen der vorherigen Phasen wird ein detaillierter Plan erstellt. Dieser umfasst die Festlegung von Teilzielen, die Zuordnung von Fachbeteiligungen, die Planung des Zeitrahmens und die Klärung offener Fragen. Eine sorgfältige Planung ist essenziell für den reibungslosen Ablauf der darauffolgenden Phasen.
-
Vorbereitungsphase: In dieser Phase werden alle notwendigen Ressourcen beschafft und organisatorische Schritte unternommen. Dazu gehören die Sicherstellung der Finanzierung, die Materialbeschaffung, die Bildung von Arbeitsgruppen und die Vermittlung spezifischer Fertigkeiten, die für die Projektdurchführung erforderlich sind.
-
Realisierungsphase: Dies ist die Phase der eigentlichen Umsetzung, in der die geplanten Aktivitäten durchgeführt werden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten aktiv an ihren Aufgaben, wenden ihr Wissen praktisch an und entwickeln Lösungen für die gestellten Arbeitsaufträge.
-
Rückbesinnungsphase: Abschließend erfolgt eine Reflexion des gesamten Projekts. Die Ergebnisse werden dokumentiert und präsentiert. Es findet eine Auswertung der Lernprozesse statt, bei der sowohl Erfolge als auch Herausforderungen analysiert werden. Diese Phase fördert das Bewusstsein für den eigenen Lernprozess und bietet Ansatzpunkte für zukünftige Verbesserungen.

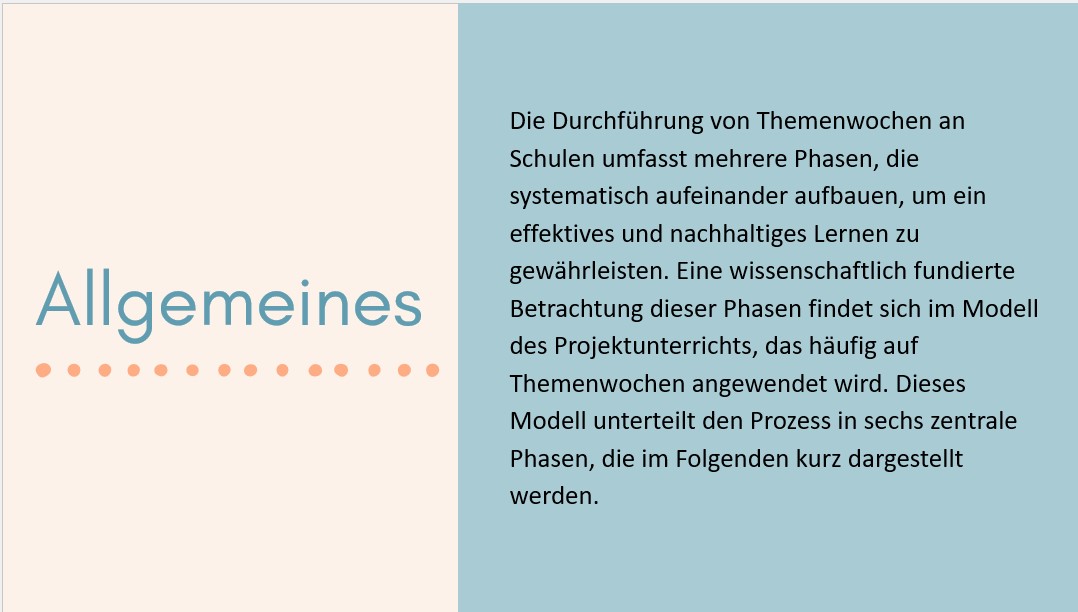

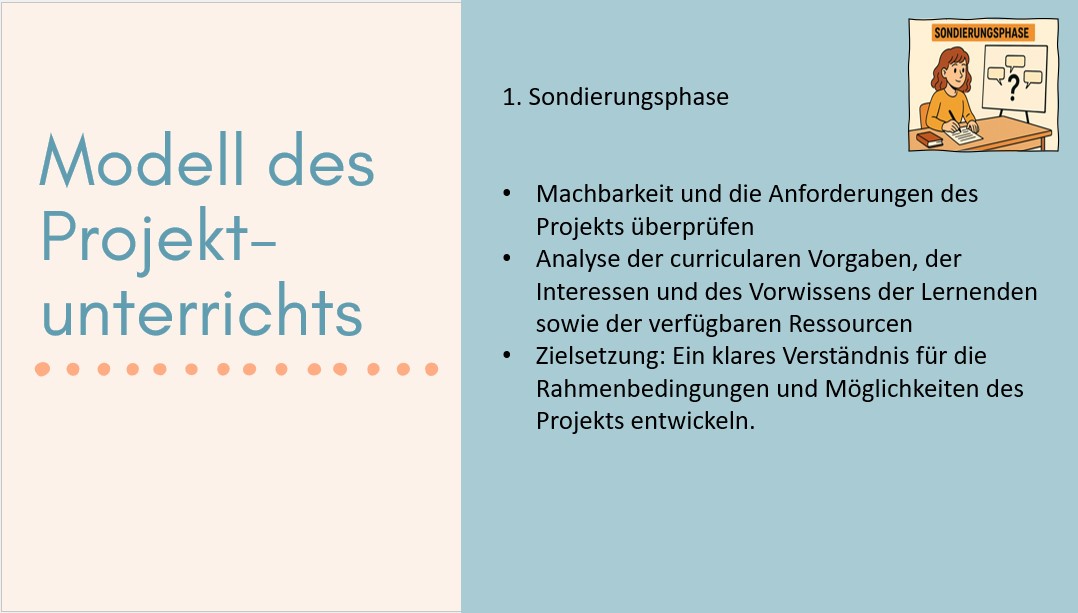
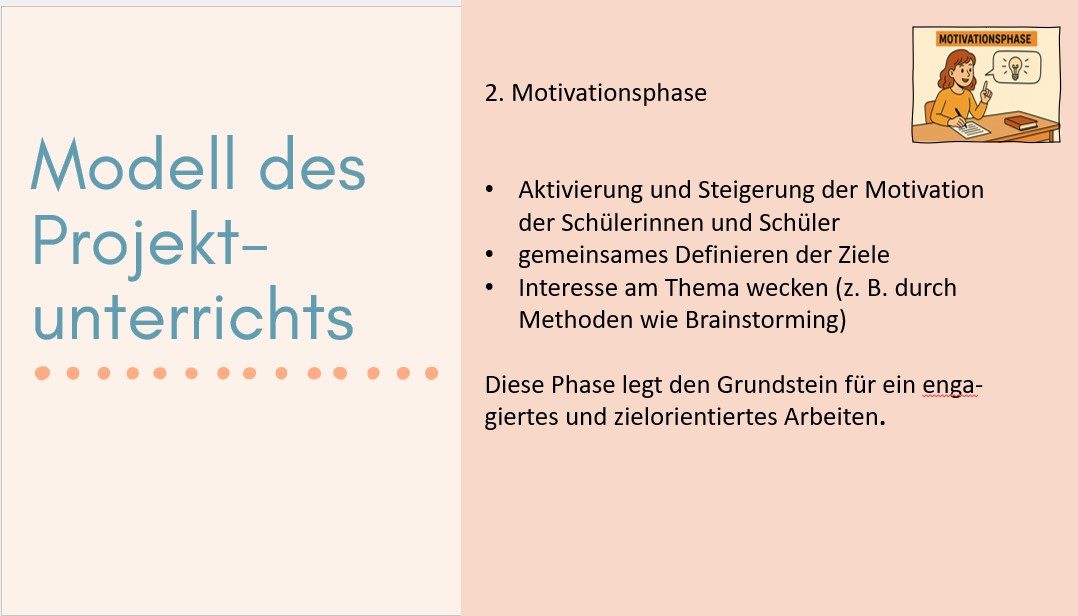
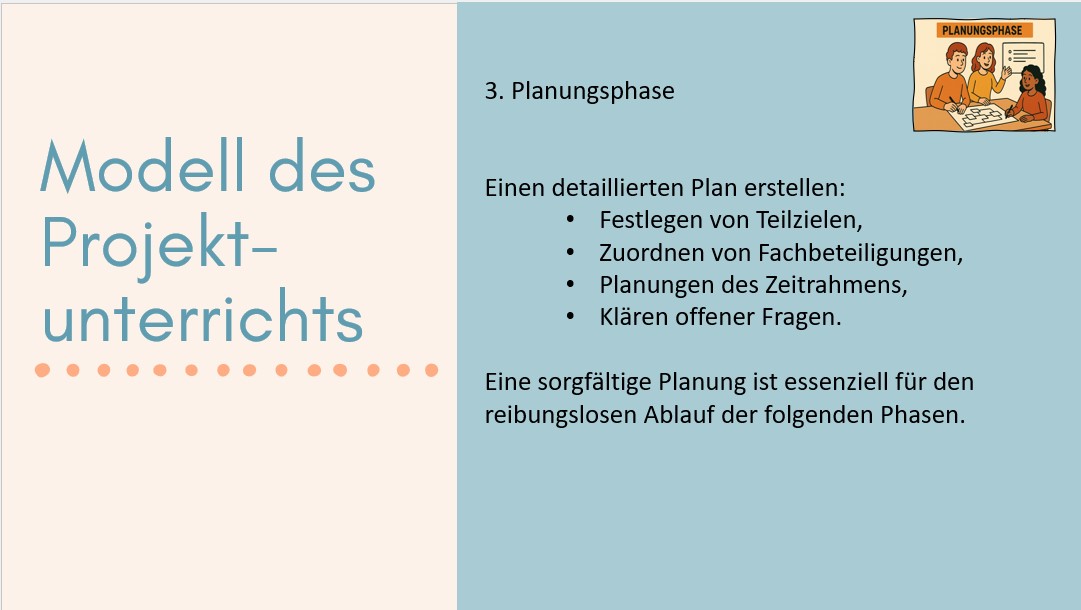
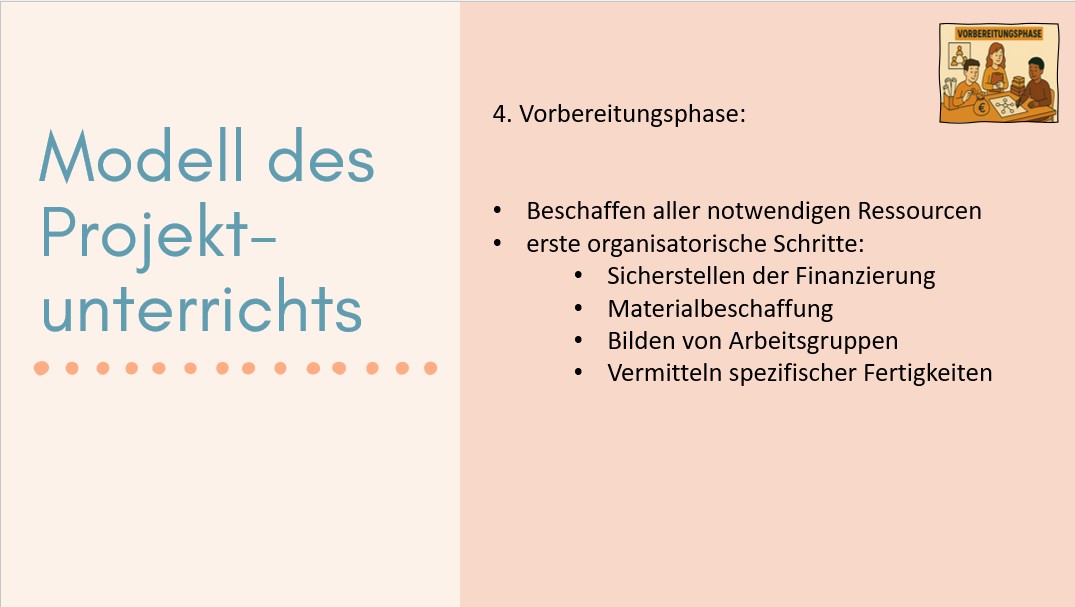
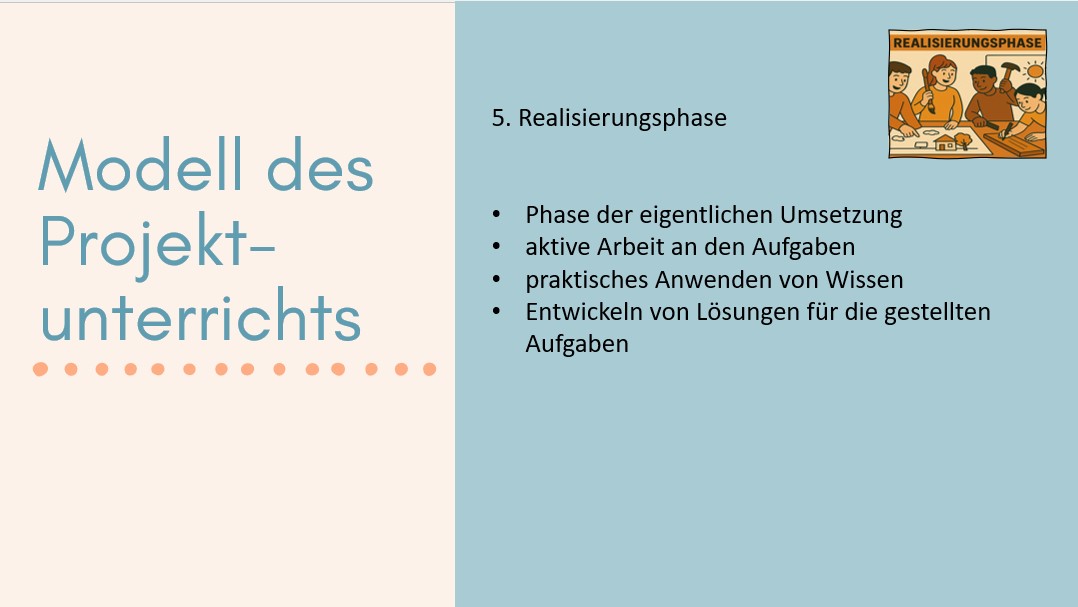
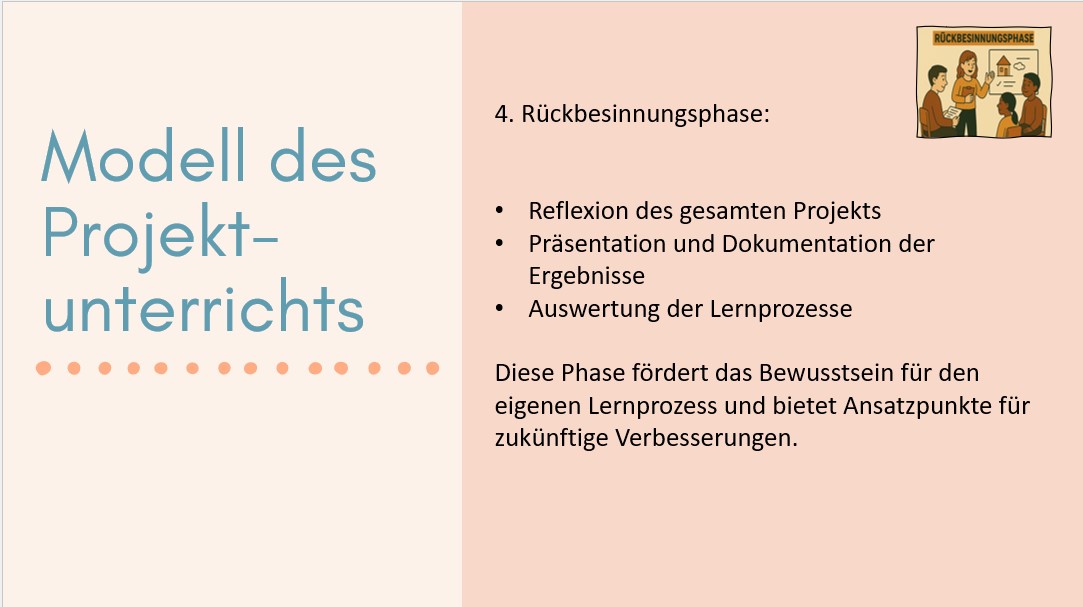
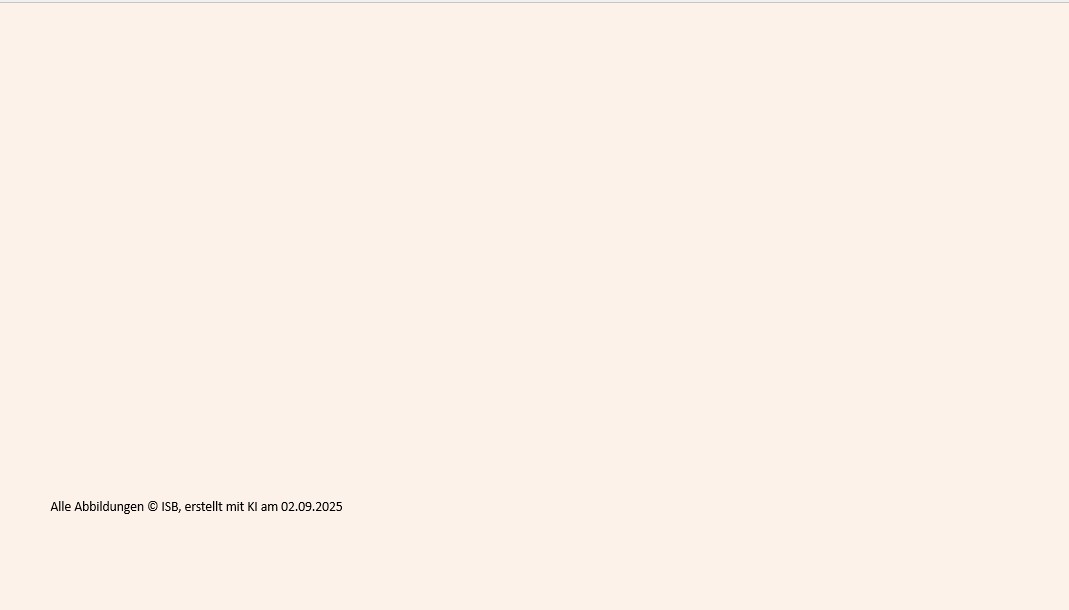
Meyer, Hilbert/Junghans, Carola: Unterrichtsmethoden II. Praxisband, Berlin 202117, S. 144.
Peterßen, Wilhelm: Fächerverbindender Unterricht. Begriff, Konzept, Planung, Beispiele, München 2000, S. 65.
Warwitz, Siegbert/Rudolf, Anita: Projektunterricht. Didaktische Grundlagen und Modelle, Schorndorf 1977, S. 41.
Eine illustrierende Planungsskizze zu einer Themenwoche “Zusammenhalt in Europa” für die Jahrgangsstufe 7 finden Sie hier.


